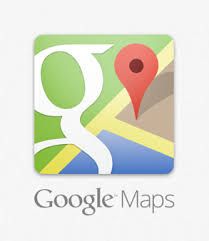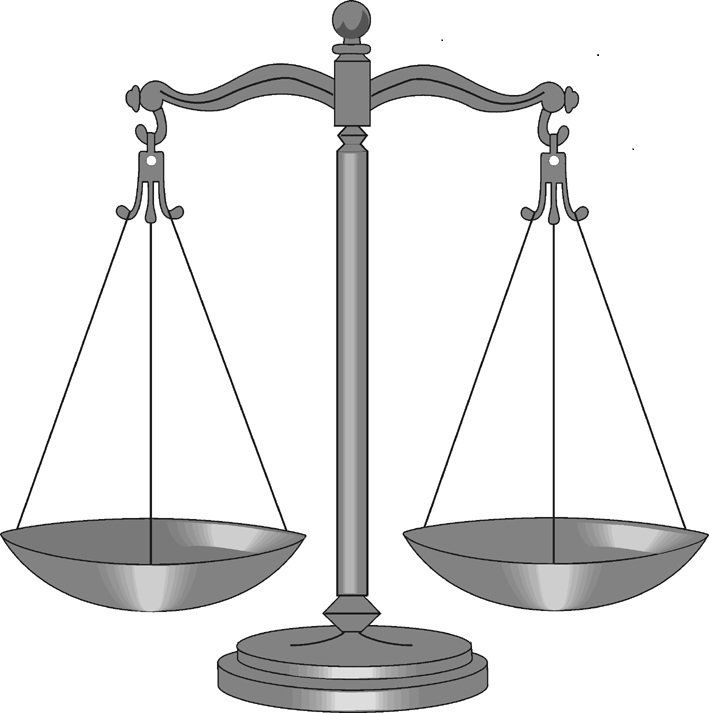


Unterhalt
Unterhalt
Zu den wichtigsten Regelungsbereichen gehört der Kindesunterhalt minderähriger Kinder.
Wenn minderjährige Kinder im Spiel sind, ist bei einer Trennung, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, immer eine Regelung zum Kindesunterhalt erforderlich.
Auch wenn sich der unterhaltsverpflichtete Elternteil freiwillig zur Unterhaltszahlung verpflichtet, ist es dennoch wichtig, einen so genannten Unterhaltstitel zu haben, nicht nur für den versorgenden Elternteil, sondern auch für das Kind selbst. Denn wenn das Kind volljährig ist, kann es seine Ansprüche auf Volljährigenunterhalt während der Ausbildung realisieren, ohne vor das Gericht ziehen zu müssen.
Bei einer Trennung von Eheleuten kann der Ehegatte, der ein geringeres Einkommen erzielt, während der Trennungszeit Trennungsunterhalt und nach der Scheidung nachehelichen Unterhalt verlangen.
Eine nicht verheiratete Mutter kann in den sechs Wochen vor der Geburt und in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes und unter Umständen sogar noch länger Betreuungsunterhalt verlangen.
Der Unterhalt für minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die sich in allgemeiner Schulausbildung befinden, ist vorrangig vor dem Ehegattenunterhalt und Betreuungsunterhalt. Diese sind wiederum vorrangig vor dem Unterhalt volljähriger Kinder.
Die Ermittlung des Unterhalts hängt von einer Reihe von Komponenten ab, die nur von einem spezialisierten Rechtsanwalt zutreffend ermittelt werden können.
Der Unterhalt kann nur für die Zukunft verlangt werden. Insofern verlieren Sie berechtigte Unterhaltsansprüche, solange Sie diese nicht geltend machen, unwiederbringlich.
Unterhaltspflichtiger beim Kindesunterhalt
Wer zur Zahlung des Kindesunterhalts verpflichtet ist und wie hoch die Zahlunspflicht ist, hängt davon ab, wie der Umgang für das Kind geregelt ist.
Residenzmodell
Lebt das Kind bei einem Elternteil und der andere Elternteil hat gar keinen Kontakt zum Kind oder lediglich alle 14 Tage an den Wochenenden ein Besuchsrecht, dann ist das so genannte
Residenzmodell
einschlägig. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der betreuende Elternteil sogenannten Naturalunterhalt leistet also das Kind betreut und versorgt der andere Elternteil den Barunterhalt leistet also den Unterhalt als Geldbetrag zahlt. Die Höhe des Unterhalts wird allein aus dem bereinigten Einkommen des
barunterhaltspflichtigen Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt, entsprechend seiner Einkommensstufe und entsprechend der Altersstufe des Kindes nach der
Düsseldorfer Tabelle ermittelt. Vom Tabellenbetrag wird noch das halbe Kindergeld abgezogen.
Der Unterhaltspflichtige muss mindestens Unterhalt in der geringsten Einkommensstufe in Höhe des sogenannten Mindestunterhalts zahlen. Nur im Ausnahmefall kann er den Mindestunterhalt unterschreiten.
Wechselmodell
Wird das Kind von beiden Eltern im Wechsel zu gleichen Teilen (50 %) versorgt, handelt es sich um das Wechselmodell. Bei diesem Modell leisten beide Eltern den Naturalunterhalt (die Versorgung des Kindes) und den Barunterhalt (die Finanzierung des Kindes). Bei diesem Modell kommt es auf das Einkommen beider Elternteile an. Beide Eltern müssen sich entsprechend ihrer Einkommensquote am Unterhalt beteiligen. Wenn das Einkommen der Eltern differiert, muß der besserverdienende Elternteil eine Ausgleichszahlung leisten. Ebenso wenn ein Elternteil die Fixkosten (Essengeld, Kita, Hort) allein leistet. Auch das Kindergeld muss verrechnet werden. Hier ist die Berechnung deutlich komplizierter.
asymmetrisches Wechselmodell
Lebt das Kind noch nicht in einem Wechselmodell hat es aber einen erweiterten Umgang mit dem umgangsberechtigten Elternteil, handelt es sich um ein
asymmetrisches Wechselmodell
. Das sind die Fälle in denen ein Elternteil mehr als 30 % aber weniger als 50 % Betreuungszeit für das Kind übernommen hat. Derzeit ist dieses Modell das überwiegend praktizierte Umgangsmodell.
Grundsätzlich muss auch hier das Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt wie beim Residenzmodell allein für den Unterhalt aufkommen.
Die Rechtsprechung hat versucht, dem erhöhten Betreuungsaufwand des umgangsberechtigten Elternteils Rechnung zu tragen, indem sie entschieden hat, dass die Unterhaltspflicht dadurch reduziert werden kann, dass der Unterhaltsverpflichtete nur nach einer geringeren Einkommensstufe Unterhalt zahlen musste. Die Untergrenze war jedoch immer der Mindestunterhalt. Auch bei einem erhöhten Betreuungsaufwand des unterhaltspflichtigen Elternteils durfte der Mindestunterhalt nicht unterschritten werden.
Diese Lösung ist unbefriedigend, da der überwiegende Teil der Unterhaltspflichtigen oft sowieso nur den Mindestunterhalt zahlen muss und so trotz der erhöhten Betreuungszeiten seine Unterhaltspflicht nicht reduziert werden kann. Derzeit wird angestrebt diesen Missstand durch eine Unterhaltsreform zu beseitigen, die genau diesen Fall des erweiterten Umgangs angemessen berücksichtigt.
Unterhalt beim Volljährigen
Beim
Volljährigenunterhalt
wird genau wie beim Wechselmodell das Einkommen
beider Elternteile quotal
berücksichtigt. Somit sind beide Eltern dem volljährigen Kind gegenüber unterhaltsverpflichtet.

Zum Einkommen zählt:
- Erwerbseinkommen (Lohn, Gehalt)
- 1/3 der Auslöse,
- Weihnachtsgeld,
- Urlaubsgeld,
- Prämien,
- Tantiemen,
- Abfindungen,
- Überstunden,
- Nebeneinkommen,
- Einkommen aus selbständiger Tätigkeit
Aber auch Sozialleistungen
- Krankengeld,
- Arbeitslosengeld,
- Übergangsgeld
- Renten
Ebenso
- Steuererstattungen,
- Mieteinnahmen,
- Einkünfte aus Kapital (Dividenden, Zinsen, Ausschüttungen)
- Ein Wohnvorteil für das kostenlose Wohnen in der eigenen Immobilie wird berücksichtigt
Im Ausnahmefall kann auch das Vermögen herangezogen werden.
Das Einkommen des Unterhaltspflichtigen muss bereinigt werden:
- durch die Fahrtkosten zur Arbeit, sowie weitere Kosten wie Gewerkschaft, Fortbildung, Arbeitskleidung
- Ehebedingste Kredite
- Steuerzahlungen
- Krankenversicherungen inclusive Zusatzversicherungen
- Berufsunfähigkeit/Berufshaftpflicht
- zusätzliche Altersvorsorge wie Bausparvertrag, Rentenversicherung, Lebensversicherung, Sparvertrag
Hinzu kommen noch weitere Kriterien, die die Höhe des berücksichtigungsfähigen Einkommens des Unterhaltsverpflichteten beeinflussen.
Leistungsfähigkeit
Der Unterhaltsverpflichtete muss nur im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit Unterhalt zahlen.
Ihm muss der notwendige Selbstbehalt verbleiben.
Dieser Selbstbehalt reduziert sich, wenn er mit einer weiteren Person mit eigenem Einkommen zusammenwohnt und sich dadurch die Wohnkosen reduzieren (sogenannter Synergieeffekt).
Wenn das Einkommen oberhalb des Selbstbehalts nicht ausreicht, um wenigstens den Mindestunterhalt zu zahlen, handelt es sich um einen Mangelfall. Hier muß zunächst geprüft werden, ob der Unterhaltspflichtige seine Obliegenheit, ein ausreichendes Einkommen zu erzielen, auch erfüllt. Wenn er dies nicht tut, wird er so behandelt, als ob er leistungsfähig wäre. Ansonsten ist er nur in Höhe seines Einkommens unterhaltspflichtig.
Bei mehreren minderjährigen Kindern müssen sich die Kinder das zur Verfügung stehende Einkommen quotal teilen.
Im Mangelfall oder bei völliger Leistungsunfähigkeit können ersatzweise auch nachrangige Unterhaltspflichtige wie der andere naturalunterhaltspflichtige Elternteil oder die Großeltern zum Unterhalt herangezogen werden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen
Bitte versuchen Sie es später noch einmal